Inhalt:
Schlosspark Herrenchiemsee
Einen Plan der Herreninsel finden Sie im Prospekt "Herrenchiemsee".
Anlagenvorschriften Herreninsel

In der Reihe der gebauten Traumwelten König Ludwigs II. kam dem Nachbau der Schloss- und Gartenanlage von Versailles als Inbegriff monarchischen Glanzes oberste Priorität zu. Ab 1868 liefen die Planungen zu diesem Projekt. Als Baugelände erwarb Ludwig II. 1873 die Chiemseeinsel Herrenwörth, nachdem sich der ursprünglich ausgesuchte Standort im Graswangtal bei Ettal als zu klein erwiesen hatte. Anstelle des Versailles-Nachbaues entstand hier aus einem Nebengebäude Schloss Linderhof.

Es lag nicht in der Absicht Ludwigs II., Versailles detailgetreu zu kopieren. Die zentralen Räume im Mitteltrakt des Schlosses – hier besonders bedeutend das Paradeschlafzimmer und der Spiegelsaal – genügten ihm, sich in die Rolle des Sonnenkönigs einzufinden. Auf die von Hofgärtendirektor Carl von Effner ab 1875 geplanten Gartenanlagen übertragen bedeutete dies, dass nur die Gartenräume in der Mittelachse detailliert nachgebildet werden mussten.
Es waren dies Richtung Westen das "Parterre d'eau", bestehend aus zwei großen, auf Wunsch Ludwigs II. durch die Figuren der Fama und Fortuna mythologisch überhöhten Bassins, das Blumenparterre mit dem Latonabrunnen sowie der "Grand Canal", vor dessen spiegelnder Oberfläche sich der Apollobrunnen erheben sollte. Vor dem Schlafzimmer erstreckte sich Richtung Osten die auf eine Länge von 900 Metern projektierte Auffahrtsallee, an deren seeseitigem Ende eine Schiffsanlegestelle geplant war.
Nach umfangreichen Erdbewegungen konnten die Gartenarbeiten 1882 – vier Jahre nach der Grundsteinlegung des Schlosses im Mai 1878 – in Angriff genommen werden. Die Ausführung der für das Herrenchiemsee-Erlebnis so wichtigen Gartenmittelachse – die in der Fläche etwa ein Drittel der geplanten Gesamtanlage umfasste – wurde mit Hochdruck betrieben und bis zum Tod König Ludwigs II. im Juni 1886 weitgehend abgeschlossen. Nur der Apollobrunnen und die Schiffsanlegestelle blieben unvollendet.

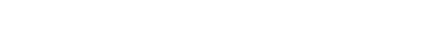
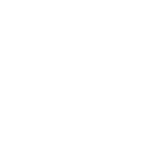
Facebook Instagram Blog der Schlösserverwaltung YouTube